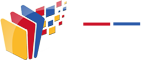Dr. Georg Halper
Jus, Opern
Nach der Matura Jus-Studium (Doktorat und 1978 nachgereichter Magister) und Gerichtspraxis.
Vom 1. 5. 1977 bis 30. 9. 2014 im Landesdienst (Steiermärkische Landesregierung), seit 1. 10. 2014 im Unruhestand.
Opernsammlung von ca. 500 Gesamtaufnahmen verschiedener Opern (Hauptgebiet Italien von Vaccaj bis Zandonai und Frankreich) - insgesamt ca. 800 Gesamtaufnahmen; ca. 50 Gesamtaufnahmen von verschiedenen Operetten (von manchen mehrere).
Die Liste der Opernkomponisten wurde von Halper erstellt und überprüft.
Veröffentlichungen
Artikel in der Zeitschrift der Grazer Opernfreunde über Filippo Marchetti und Giacomo Puccini.
Vorträge
u. a. bei der Societá Dante Alighieri, den Grazer Opernfreunden, dem Absolventenverein "alumni" der Grazer Universität, dem Kulturverein Graz-Straßgang, dem Seniorenbund Graz-Geidorf, dem Odilien-Blinden-Institut, dem Aktiven Lebens Abend, Bad Ischl-Kaiservilla.
Hobbies
Opernraritäten, Gartenarbeit, Hund (Spaniel), Markensammlung, Ausstellungsbesuche, Reisen (vor allem Italien, speziell Venedig), Treffen mit Freunden.
Mitarbeit als ehrenamtliches Mitglied des Editorial Boards
1… Präsentation der wichtigsten Komponisten und ihrer Opern
2...Opernprogramm von ca. drei Monaten:
Opernvorschau April 2025
Ö1 MHz 91,2 Beginn im Regelfall 19:30 Uhr
5.: Sergej Prokofiew: „Die Verlobung im Kloster“, UA 1946 in Leningrad – Wr. Staatsoper 19:00 Uhr – LIVE!
12.: Gaetano Donizetti: „Lucrezia Borgia“; UA 1833 in Mailand – Röm. Oper 2025
19.: Richard Strauss: „Arabella“, UA 1833 in Dresden – Wr. Staatsoper 19:00 Uhr - LIVE
26.: Modest Mussorgski: „Chowanschtschina“, UA 1886 in St. Petersburg – Osterfestspiele Salzburg 2025
Weitere Termine: sonntags 15:05 Uhr, donnerstags 14:05 Uhr
3.: W. A. Mozart „Il re pastore“, Messen usw.; 6.: Marcello Viotti – 20. Todestag;
10.: Verdi heute in Italien – aus Florenz und Parma; 13.: Oper aus Österreich – Bundesländerbühnen und Volksoper; 17.: Claudio Monteverdi (und seine „Wiederbeleber“ – Orff, Hindemith, Krenek und Montemezzi);
20.: Fiorenza Cossotto – 90. Geburtstag; 24.: Wilma Lipp – 100. Geburtstag; 27.: Das Wiener Staatsopernmagazin
Besondere Hinweise:
18.: (Karfreitag): Johann Sebastian Bach: „Johannes Passion“; 21.: (Ostermontag): Georg F. Händel: „La risurrezione“, jeweils um 19:30 Uhr.
12.: Natalie Dessay – 60. Geburtstag (10:05 Uhr); 22.: Aus Opern zum April, u. a. aus „Don Pasquale“ von Donizetti, „Edgar“ von Puccini, „Zaza“ von Leoncavallo, „Martha“ von Flotow (10:05 Uhr).
Radio Klassik Stephansdom MHz 94,2 Beginn im Regelfall 20:00 Uhr
1.: Richard Wagner: „Lohengrin“, 1850 in Weimar
3.: Max Bruch: „Moses“, UA 1895 in Barmen
5.: Albert Roussel: „Padmavati“, UA 1923 in Paris
8.: Saverio Mercadante: „Il Giuramento“, UA 1837 in Mailand
10.: Nicola Porpora: „Orlando“, UA 1720 in Neapel
12.: Luigi Cherubini: „Medea“, UA 1797 in Paris
15.: Richard Wagner: „Parsifal“, UA 1882 in Bayreuth, 1. + 2. Aufzug
17.:Richard Wagner: „Parsifal“, UA 1882 in Bayreuth, 3. Aufzug, 20:40 Uhr
22.: Johann Strauss: „Das Apfelfest“, UA 1894 in Wien
24.: Gioacchino Rossini: „Il Barbiere di Seviglia“, UA 1816 in Rom
26.: Giuseppe Verdi: „Ernani“, UA 1844 in Venedig
29.:Francois A. Boieldieu: „La Dame Blanche“, UA 1825 in Paris
In diesem Monat möchte ich besonders auf Saverio Mercadante hinweisen, zumal am 8. April sein Meisterwerk „Il Giuramento“ (Der Schwur) kennen zu lernen sein wird.
Zu dieser speziellen Aufnahme vom 9. September 1979 in der Wiener Staatsoper können wir in dem der CD beigelegten Booklet folgende Erinnerungen von Marcel Prawy, damals Chefdramaturg der Wiener Staatsoper, lesen:
Der Tenor Peter Dvorsky war mit der Hauptrolle (Viscardo di Benevento) besetzt. Die (konzertante) Aufführung sollte am Sonntag stattfinden. Am Donnerstag sagte Peter Dvorsky krankheitshalber ab. Wir haben gewusst, dass niemand diese Partie in so knapper Zeit erarbeiten könnte. Damit schien die Produktion gestorben zu sein. Am selben Tag tauchte Domingo auf. Ich hatte keine Ahnung, dass er überhaupt in Wien war. Er betrat mein Büro in der Staatsoper und bat, mein Telefon benützen zu dürfen. Danach erfuhr ich von ihm, dass er in den folgenden drei Tagen Schallplattenaufnahmen habe. „Und am Sonntag geht´s nach Barcelona und danach nach New York.“ Ich wollte bloß einen dummen Spaß machen und sagte: „Placido, am Sonntag kannst du nicht abreisen, denn am Sonntag singst du bei uns noch Giuramento.“. Domingo: „Was redest du für einen Unsinn? Erstens, was ist Giuramento? Was singe ich bei euch am Sonntag? Nichts!“ Ich spielte die Qualitäten des Mercadante ein bisschen hoch. Domingo verabschiedete sich, kehrte aber nach eine halben Stunde zurück und bat um den Klavierauszug… Er nahm ihn mit. Da überlegte ich: Wird er wirklich einspringen? Ausgeschlossen! Jedenfalls berichtete ich sofort meinem Direktor Seefehlner. Der darauf: „Ich nehme das ernst!“ Er bat Domingo zu sich. „Hören Sie mal zu, Egon“ sagte Domingo „Wenn meine Aufnahmen bis Samstag ordnungsgemäß fertig sind und wenn ich wirklich nur eine Probe am Samstag Nachmittag machen muss, singe ich euch am Sonntag euren Giuramento“. Domingo sang Il giuramento. Während alle seine Kollegen von den Notenständern abgelesen haben, blickte Domingo stets nur aus dem Augenwinkel in die Noten und agierte fast frei, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes als Giuramento gesungen.
Aber auch die Besetzung der weiteren Hauptrollen kann sich sehen lassen: Manfredo, Conte di Siracusa war mit Robert Kerns besetzt, Bianca, seine Frau mit Agnes Baltsa, Elaisa, eine französische Dame mit Mara Zampieri.
Saverio Mercadante wurde 1795 in Altamura, nahe Bari, geboren. Er studierte Flöte, Violine und Kompositionslehre in Neapel. Der große Rossini sagte zum Direktor des Konservatoriums, dem Komponisten Zingarelli: „Mein Kompliment Meister, Ihr junger Schüler Mercadante beginnt dort, wo ich aufgehört habe!“. Von 1840 an leitete er das Konservatorium von Neapel, erblindete 1863 und starb 1870 in Neapel.
Mercadante hat rund 60 Opern komponiert – etliche davon kann man auf Schallplatte oder CD hören: „Caritea, regina di Spagna“ (UA1816 in Venedig), „Don Chiscotte alle nozze di Gamaccio“ (UA 1830 in Cadiz), „Francesca da Rimini“ (komp. 1831 – UA 2016 in Martina Franca!), „Zaira“ (UA 1831 in Neapel), „Emma d´Antiochia“ (UA 1834 in Venedig), „I Briganti“ (UA 1836 in Paris), „I due Figaro“ (UA 1835 in Madrid), „Il Giuramento“ (UA 1837 in Mailand), „Il Bravo“ (UA 1839 in Mailand), „Elena da Feltre“ (UA 1839 in Neapel), „La Vestale“ (UA 1840 in Neapel), „Il Proscritto“ (UA 1842 in Neapel), „Il Reggente“ (UA 1843 in Turin), „Gli Orazi e Curazi“ (UA 1846 in Neapel), „Pelagio“ (UA 1857 in Neapel), „Virginia“ (UA 1866 in Neapel). Highlights gibt es auch aus „Maria Stuarda, regina di Scozia“ (UA 1821 in Turin) und „I Normanni a Parigi“ (UA 1832 in Neapel). Es lohnt, sich einmal näher mit Mercadantes Werk auseinander zu setzen!
Aber auch auf Max Bruch möchte ich aufmerksam machen. Geboren wurde er im Jahr 1838 in Köln und war Komponist und Dirigent. Er komponierte Bühnenwerke/Opern, Orchesterwerke, Konzerte und Konzertstücke, Vokalmusik (Geistliche Chorwerke, Weltliche Chorwerke mit und ohne Solostimmen, Lieder), Kammermusik, Klaviermusik und Orgelwerke. Seine Bühnenwerke sind heute vollkommen unbekannt: „Scherz, List und Rache“, UA 1858 in Köln, „Die Loreley“, UA 1863 in Mannheim (diese Oper ist höchstens Kennern bekannt!), „Herminone“, UA 1872 in Berlin, sowie „Claudine von Villa Bella“; UA unbekannt. Das Werk, das wir kennen lernen dürfen, ist „Moses“, ein Oratorium, das 1893/94 entstanden ist.
Das einzige Werk, das ihn bekannt gemacht – und überlebt hat – ist sein Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op 26, komponiert in den Jahren 1865 – 67. Auf Grund seiner finanziellen Probleme hatte er das Werk für ein einmaliges Honorar von 250 Talern an den Verleger Cranz verkauft – und hatte somit von diesem (einzigen wirklichen) Erfolgswerk nichts.
Im Frühjahr 1920 wurde er pflegebedürftig, war aber geistig noch voll aktiv. Im Oktober desselben Jahres verstarb er.
Johann Strauss – heuer gedenken wir seines 200. Geburtstages. Und so können wir eine weitere unbekannte Operette von ihm kennen lernen: „Jabuka – oder Das Apfelfest“. Es handelt sich hier um die 14. Operette des Walzerkönigs. Die Uraufführung fand im Jahr 1894 statt – zum 50. Künstlerjubiläum in Dommayers Casino in Hietzing. Strauss nahm hier ein slawisches Sujet auf – angeregt durch Bedrich (Friedrich) Smetana und seine Oper „Die verkaufte Braut“.
Die Operette, sie ist dreiaktig, spielt in Serbien im 19. Jahrhundert. Die Personen der Handlung sind: Mirko und Vasil von Gradinaz, zwei verarmte Adelige; Mischa, ein reicher Bauer; Jelka, dessen Tochter; Petrija, deren Tante; Brambora, ein reicher Fabrikant; Anita, dessen Tochter; Franjo, ein Gerichtsvollzieher; Joschko, sein Gehilfe; Stalko, der Gastwirt; Volk.
Das Apfelfest, ein folkloristisches Fest, findet in einem Landgasthof zwischen zwei serbischen Städten, Gradinaz und Raviza, statt. Hier finden sich zukünftige Paare. Ein junger Mann, der sich für ein Mädchen interessiert, beißt in einen Apfel und reicht ihn seiner Auserwählten. Mag ihn das Mädchen, beißt es ebenfalls in den Apfel, wenn nicht, gibt es ihn dem Burschen „ungebissen“ zurück. Anita und Vasil finden sehr rasch zusammen, während Jelka Mirko den Apfel – nur von ihm hat sie einen bekommen - vor die Füße wirft. Joschko darf sich als Magnat verkleiden – und so gibt es manche „Wirrnis“. Joschko bringt sie – gegen Geld – statt nach Raviza nach Gradinaz. Aber es kommt dann doch anders, denn Jelka muss erkennen, dass sie nicht in Raviza sondern in Gradinaz, in Mirkos Schafzimmer war. Zuletzt verlieben sich die beiden doch noch!
Das Libretto ist, wie meistens, schwach. Hier finden wir einen Strauss mit beschwingten und zündenden Melodien – jedoch nicht mehr ganz auf der Höhe; fünf Jahre vor seinem Tod. So verwundert es nicht, dass es „Jabuka“ nur auf sechzig Aufführungen brachte.
Monatlich einmal gibt es bei Radio Klassik die Sendereihe „Per Opera ad Astra“ mit Dr. Richard Schmitz. Diesmal bringt er „Arabella“ von Richard Strauss – mit Erklärungen und Musikbeispielen (12. 4., 14:00 Uhr, Wh. 16. 4., 20:00 Uhr).
Und eine weitere Sendereihe, gestaltet von Dr. Wolfram Huber, möchte ich empfehlen; da befasst er sich mit verschiedenen Opernsängern (fallweise montags).
Radio Klassik Stephansdom benötigt fürs Überleben weiter unsere finanzielle Hilfe! Und so wiederhole ich meine dringende Bitte um Spenden an:
Stiftung Radio Stephansdom
IBAN: AT74 1919 0001 3922 7440
BIC: BSSWATWWXXX
Opernvorschau März 2025
Ö1 MHz 91,2 Beginn im Regelfall um 19:30 Uhr
1.: Pietro Mascagni: „Le Maschere“, UA 1901 in: Mailand, Rom, Turin, Genua, Verona und Venedig! – vom Wexford Festival 2024
8.: Giuseppe Verdi; „Falstaff“, UA 1893 in Mailand – aus der MET 1964!
15.: Vinzenco Bellini: „Norma“, UA 1831 in Mailand – aus der Wiener Staatsoper
22.: Johann Strauss: „Der Karneval in Rom“, UA 1873 in Wien – aus dem Theater a. d. Wien
24.: Peter I. Tschaikowsky: „Iolanta“, UA 1892 St. Petersburg – aus Wiener Staatsoper - LIVE!
29.: Giuseppe Verdi: „La Traviata“, UA 1853 in Venedig – aus der MET 2007
Weitere Termine: sonntags um 15:05 Uhr, donnerstags um 14:05 Uhr
2.: „Apropos Oper“ – 150 Jahre „Carmen“; 6.: „Orpheus Britannicus“ – mit Ferrier - Deller 9.: „Die Königin von Saba“ – Uraufführung am 10. 3. 1875
13.: 135 Jahre „Cavalleria Rusticana“ von Pietro Mascagni; 16.: Johann Strauss-Operetten, wie „Der Zigeunerbaron“, „Wiener Blut“ „Die Fledermaus“, dirigiert von Robert Stolz,
20.: Französische Tenöre: Benjamin Bernheim, Roberto Alagna, Alian Vanzo, Michel Sénéchal usw.; 23.: Oper aus Österreich – Bundesländerbühnen und Volksoper; 27.: Gustav Albert Lortzing – volkstümliche Opern im „Aussterben“?
30.: Das Wiener Staatsopernmagazin
Radio Klassik Stephansdom MHz 94,2 Beginn jeweils um 20:00 Uhr
1.: Georges Bizet: „Carmen“, UA 1875 in Paris
4.: Gustave Adolphe Kerker: „The Belle of New York“, UA 1897 in New York
6. Johann Rudolphe Zumsteeg: „Die Geisterinsel“, UA 1798 in Stuttgart
8. Ottorino Respighi: „Belfagor“, UA 1923 in Mailand
11.: Carl Goldmark: „Die Königin von Saba“, UA 1875 in Wien
13. Zdenek Fibich: „Die Braut von Messina“, UA 1884 in Prag
15.: Richard Wagner: „Lohengrin“, UA 1850 in Weimar
18.: José de Nebra: „Venus y Adonis“, UA 1728 in Lissabon
20. Jules Massenet: „Griselidis“, UA 1901 in Paris
22.: Siegfried Wagner: „Sonnenflammen“, UA 1912 in Darmstadt
25.: Giuseppe Verdi: „I Lombardi“, UA 1843 in Mailand
27.: Leonard Leo: „Amor vuol Sofferenza“, UA 1739 in Neapel
29.: Umberto Giordano: „Andrea Chenier“, UA 1896 in Mailand
Pietro Mascagni – wer kennt nicht seine „Cavalleria Rusticana“, mit Uraufführung in Jahr 1890? Gleich mit der ersten Oper so erfolgreich zu sein, ist tragisch – denn alle haben nach so einem Erfolg eine Erwartungshaltung, die nicht zu erfüllen ist. In weiterer Folge „lief“ er seinem Erfolg nach: „L´Amico Fritz“, UA 1891 in Rom (Opernliebhaber kennen das „Kirschenduett“), „I Rantzau“, UA 1892 in Florenz, „Guglielmo Ratcliff“, UA 1895 in Mailand, „Silvano“, UA 1895 in Mailand, „Zanetto“, UA 1896 in Pesaro, „Iris“, UA 1898 in Rom (hier kennt man bestenfalls den herrlichen Sonnengesang). Im Jahr 1901 folgten die in Ö1 zu hörenden „Le Maschere“. Er wollte immer wieder etwas Neues, Originelles schaffen, so auch in seiner „Amica“, UA 1905 in Monte Carlo – mit Kuhglockengeläute zu Beginn, dann „Isabeau“, UA 1911 in Buenos Aires, „Parisina“, UA 1913 in Mailand, „Lodoletta“, UA 1917 in Rom, „Il piccolo Marat“, UA 1921 in Rom, sowie „Nerone“, UA 1935 in Rom. Mascagni wurde von Mussolini sehr geschätzt, war seit 1932 auch Mitglied der Faschistischen Partei – und das tat ihm nicht gut; er geriet in Vergessenheit und starb 1945 verarmt. Aber es gibt aus den Jahren 1938 (Bruna Rasa, Meloni Melandri, Poli und Gallo Toscani) und 1940 (Bruna Rasa, Gigli, Simionato, Bechi und Marucci) Aufnahmen seiner „Cavalleria“ unter seinem Dirigat – und so weiß man, wie er sie dirigiert haben wollte.
Seine „Le Maschere“ – mit Figuren der Commedia dell´ Arte - höre ich immer wieder gern. Apart ist schon der Beginn mit den Gesprächen der Musiker, dem Stimmen der Instrumente, dem Einsingen – und erst dann kommt die „Sinfonia“. Vor allem den Schluss des 1. Aktes, „Stretta è la porta“, in dem das ganze Ensemble singt, liebe ich sehr. Und welche Oper wurde am selben Tag in sechs verschiedenen Städten gleichzeitig uraufgeführt? Recht interessant ist es, alle seine Opern in der Reihenfolge der Uraufführung zu hören – wie ich es im Vorjahr gemacht habe. Dazu kommen noch „In filandia“ (eigentlich eine „Vorarbeit“ zu „Pinotta“), „Pinotta“, UA 1932 in San Remo, und seine Operette „Si“, UA 1919 in Rom.
Zwei Opern, die vor 150 Jahren uraufgeführt wurden, kann man in diesem Monat hören: „Carmen“ von Georges Bizet und „Die Königin von Saba“ von Karl Goldmark.
„Carmen“ von Georges Bizet kam kürzlich auf einer DVD auf den Markt (bei dem rührigen Label „Bru Zane“, mit Sitz in Venedig, das sich der romantischen französischen Oper verschrieben hat), mit der Uraufführungsinszenierung als Vorbild und den Kostümen von damals. „Carmen“ ist wohl die bekannteste von Bizets Opern; aber es lohnt sich, sich auch näher mit seinem früheren Opernschaffen zu befassen.
„Le Docteur Miracle“ (Der Wunderdoktor), UA 1857 in Paris, spielt im Padua des 19 Jahrhunderts und ist nur einaktig. Darauf folgte „Don Procopio“, eine 2-aktige Oper, deren Handlung in Spanien, um1800, angesiedelt ist. Die Uraufführung ging erst 1906 in Monte Carlo über die Bühne, obwohl das Werk bereits 1858 komponiert wurde. Im Jahr 1863 hatten seine großartigen „Les Pécheurs de Perles“ (Die Perlenfischer) in Paris ihre Uraufführung erlebt. Die Handlung spielt im Altertum auf der Insel Ceylon (heute Sri Lanka). Die Musik ist, zumindest für mich, „berauschend“! „Iwan Le Terrible“ (Iwan IV.), schon 1865 komponiert, wurde erst 1951 in Bordeaux uraufgeführt – Russland, um die Mitte des 16. Jahrhunderts. 1867 folgte „La jolie Fille de Perth“ (Das schöne Mädchen von Perth), dessen Handlung in Perth in Schottland, um 1500, angesiedelt ist. 1872 erlebte „Djamileh“ die Uraufführung in Paris – Ort der Handlung ist Haruns Palast in Kairo, im 19. Jahrhundert. „L´Arlesienne“ (Das Mädchen aus Arles), in Frankreich in einem Dorf nächst Arles, im 19. Jahrhundert, folgt 1872 in Paris. Den Abschluss bildet 1875 „Carmen“, die jedermann bestens kennt! Hier finden sich wirkliche „Schlager“, wie die Segdillia und das Torerolied. Von all diesen Opern gibt es gute Aufnahmen. Posthum liegt noch eine weitere Oper vor: „Noe“ (von Bizet als „“Le Deluge“ [Die Sintflut] benannt); hier ist mir keine Aufnahme bekannt.
Karl Goldmark ist heute fast ganz vergessen. Am 10. März 1875 erlebte sein „Hauptwerk“ seine Uraufführung – und das nehmen sowohl Ö1 als auch Radio Klassik Stephansdom zum Anlass, auf dieses Werk aufmerksam zu machen. Vielleicht erlebt diese Oper nun doch eine Renaissance?
Karl Goldmark hat insgesamt sieben Opern komponiert:
„Die Königin von Saba“, UA 1875 in Wien (komponiert bereits 1871),
„Merlin“, UA 1886 in Wien,
„Das Heimchen am Herd“, UA 1896 in Wien,
„Der Fremdling“, UA 1897 – Ort der UA unbekannt,
„Die Kriegsgefangene“, UA 1899 in Wien,
„Götz von Berlichingen“, UA 1902 in Budapest, Neufassung 1910 in Wien,
„Ein Wintermärchen“, UA 1908 in Wien.
Interessant ist es, dass es auch eine weitere Oper mit dem Titel „Die Königin von Saba“ (La Reine de Saba) gibt – von Charles Gounod, UA 1862 in Paris. Und es gibt noch einen zweiten „Merlin“ – von Isaak Albéniz, UA 1898 in Barcelona. Interessant ist es, auch diese Opern anzuhören.
Sehr empfehlen kann ich Zdenek Fibichs „Die Braut von Messina“; es lohnt sich hier hineinzuhören. Die Vorlage zu dieser Oper lieferte Friedrich Schiller. Eine weitere Oper mit diesem Titel (La Sposa di Messina) stammt von Nicola Vaccaj – mit Uraufführung im Jahr 1839 in Venedig. Diese beiden Opern hintereinander zu hören ist lohnenswert!
Radio Klassik Stephansdom bringt am 20. d. M. eine ganz selten gespielte Oper von Jules Massenet: „Griselidis“, UA 1901 in Paris. Die Handlung spielt in Schloss Saluces in der Provence – 14. Jahrhundert – Sagenwelt. Das Label Bru Zane hat soeben eine neue Einspielung davon vorgelegt. Eine ältere Aufnahme aus dem Jahr 1992 wurde im Théatre de la Maison Esplanade, in der Operá von St. Etienne, aufgenommen.
„Norma“ von Vincenzo Bellini ist dzt. hoch im Kurs. So brachte FS2 am Vormittag des 15. Februar Ausschnitte aus dem Amphitheater in Orange (1974) mit Montserrat Caballé – sehr stimmungsvoll durch die wehenden Gewänder. Radio Klassik Stephansdom brachte am 16. Februar am Abend eine „Norma“-Sendung mit Bergonzi, Bartoli, Sutherland, Caballé, Callas, Filippeschi, Domingo ….. Und nun kann man die „Norma“ in Wien sowohl im Theater an der Wien als auch in der Staatsoper erleben. Aber „die Norma“ ist und bleibt Maria Callas – durch sie wurde diese Oper „unsterblich“. Bellini hat ja ganz großartige Opern komponiert – hier möchte ich noch zwei weitere nennen: „La Sonnambula“ (Die Nachtwandlerin), UA 1831 in Mailand – wer erinnert sich nicht an die großartige „Sonnambula“ in der Ära Nemeth im Jahr 1975, als sogar das Bühnenbild Szenenapplaus bekam?, und „I Puritani“ (Die Puritaner), UA 1835 in Paris.
Und in diesem Jahr vergeht sicher kein Monat ohne Johann Strauss-Sohn! Ö 1 trägt dem Rechnung, indem sie Robert Stolz Ausschnitte aus den besten Operetten des Meisters dirigieren lassen: „“Die Fledermaus“, „Wiener Blut“ und „Der Zigeunerbaron“ – „Eine Nacht in Venedig“ geht mir hier allerdings ab!
Und am 22. überträgt Ö 1 „Der Karneval in Rom“ von der Stätte der Uraufführung. Es ist dies seine 2. Operette – nach „Indigo und die 40 Räuber“. Die Begeisterung des Publikums war groß, aber nicht sensationell. Und so wurde die Operette bald vergessen.
Inhalt: Marie, ein Mädchen aus Savoyen, wurde von einem durchreisenden Maler, Arthur Bryk, porträtiert – dabei hat er sich mit ihr verlobt. Sie wartet vergebens auf seine Rückkehr – da kommt plötzlich ein Hochzeitszug vorbei. Zwei durchziehende Maler erzählen ihr, dass sie nach Rom zu Bryk unterwegs sind, sehen das Bild – und sie kaufen es ihr ab, um es später als ihr eigenes Werk auszugeben. Somit kann sie die Reise nach Rom finanzieren. In Rom findet sie ihren Maler wieder – aber sie bleibt inkognito, da er sie offenbar vergessen hat. Sie verkleidet sich als junger Savoyarde – und tritt so als Malschüler mit Namen Mario in seinen Dienst. Aber: Ende gut – alles gut! So nebenbei spielen auch noch ein älterer (etwas dümmlicher) Graf und eine jüngere Gräfin eine Rolle. Die Gräfin „darf“ eine schöne Koloraturarie singen.
Es sind in dieser Operette nette Melodien, so z. B. im 1. Akt ein Lied der Marie –„Die Glocken, sie hallen“. Im 2. Akt tritt Bryk als frommer Pilger, der angeblich eben aus dem Heiligen Land zurückgekommen ist, auf und versteigert Stücke, die er angeblich von dort mitgebracht hat, um zu Geld für seine Künstlerfeste zu kommen - „Gott grüß euch …….. – wer bietet mehr?“ Das Höchstgebot für die beiden Stücke liegt dann je bei 100 Lire – damals ein Vermögen. Im letzten Akt kommt zuletzt die große „Erkennungsszene“ – und die Versöhnung kann nicht ausbleiben.
Was würden wir Opernfreunde ohne Radio Klassik Stephansdom machen?
Und daher nun wieder meine dringende Bitte um Spenden für Radio Klassik Stephansdom!
Stiftung Radio Stephansdom
IBAN: AT 74 1919 0001 3922 7440
BIC: BSSWATWWXXX
Opernvorschau Februar 2025
Ö1 MHz 91,2 Beginn im Regelfall um 19:30 Uhr
1.: Wolfgang A. Mozart: „Don Giovanni“, UA 1787 in Prag - Wiener Staatsoper LIVE, 19:00 Uhr
8.: Giacomo Puccini: „Tosca“, UA 1900 in Rom – Met New York 2024
15.: Geminiano Giacomelli: „Cesare in Egitto“, UA 1735 in Venedig – Festwochen der Alten Musik in Innsbruck 2024
22.: Daniel F. E. Auber: „Manon Lescaut“, UA 1856 in Paris –Teatro Regio in Turin 2024
Weitere Termine: sonntags um 15:05 Uhr, donnerstags um 14:05 Uhr
2.: „Apropos Oper“ (leider war vom ORF kein Programm erhältlich!); 6.: Raina Kabaiwanska – 90. Geburtstag (und auch weitere bulgarische Sängerinnen); 9.: „Apropos Oper“ (leider war vom ORF kein Programm erhältlich!);
13.: Komponistinnen - wie Clara Schumann, Fanny Hensel und Louise Bertin; 16.: Oper aus Österreich – Bundesländerbühnen und Volksoper
20.: Marcello Viotti – 20. Todestag; 23.: Das Wiener Staatsopernmagazin; 27.: Heiterer Rossini und Donizetti in deutscher Sprache
Radio Klassik Stephansdom MHz 94,2 Beginn jeweils um 20:00 Uhr
1.: Wolfgang A. Mozart: „Don Giovanni“, UA 1787 in Prag
4.: Georg Friedrich Händel: „Belshazzar“, UA 1745 in London
6.: Franz Lehár: „Die lustige Witwe“, UA 1905 in Wien
8.: Richard Wagner: „Tristan und Isolde“, UA 1865 in München
11.: Johann Strauss II.: „Simplicius“, UA 1887 in Wien
13.: Leo Delibes: „Lakmé“; UA 1883 in Paris
15.: Carl Maria von Weber: „Der Freischütz“, UA 1821 in Berlin
18.: Vincenzo Bellini: „Beatrice di Tenda“, UA 1833 in Venedig
20.: Johann Adolf Hasse: „Marc´Antonio e Cleopatra“, UA 1725 inNeapel
22.: Hans Pfitzner: „Palestrina“, UA 1917 in München
25.: Joseph Haydn: „La Fedeltá premiata“, UA 1780 in London
27.: Giuseppe Verdi: „Gustavo III.“, UA 1859 in Rom
Radio Klassik Stephansdom „beschenkt“ uns Monat für Monat mit drei Opernabenden pro Woche, am Samstag-, Dienstag- und Donnerstag-Abend. In diesem Monat stehen nur drei Opern auf dem Programm, die ich nicht daheim habe, am 4., 20. und 25. d. M.!
Da heuer der Aschermittwoch sehr spät ist – erst Anfang März – „läuft“ der Fasching sehr lange. Und so ist es kein Wunder, wenn wir in diesem Monat zwei Operetten präsentiert bekommen.
Franz Lehárs „Die lustige Witwe“ ist wohl seine bekannteste und beliebteste Operette – der Meister war damals erst 35 Jahre alt! Hier folgt ein „Ohrwurm“ auf den anderen: der Ballsirenenwalzer, „Lippen schwiegen“ – ebenfalls ein Walzer, Danilos „Da geh´ ich ins Maxim“, Valenciennes „Ich bin eine anständige Frau“, Hannas Viljalied, oder ihre Mazurka „Hab in Paris mich noch nicht ganz akklimatisiert“, Rosillons „Komm in den kleinen Pavillon“. Weitere Highlight sind: das Marsch-Septett „Ja, das Studium der Weiber ist schwer!“, das Lied vom Reitersmann, die Geschichte von den zwei Königskindern oder das lustige Grisetten-Chanson.
Die Operette spielt in Paris und in der „Gegenwart“, also ca. 1905.
Heuer gedenken wir des 200. Geburtstages von Johann Strauss Sohn. Und so nimmt es nicht wunder, dass schon im Februar eine seiner eher unbekannteren Operetten gesendet wird – nämlich sein „Simplicius“.
Am 25. Oktober 1825 wurde der „Meister“ in Wien als Sohn des gefeierten Komponisten und Dirigenten Johann Strauss (Vater) geboren. Bereits in jungen Jahren – 1844 - war Johann Strauss Sohn sehr erfolgreich. Nach dem Tod des Vaters übernahm er dessen Orchester. 1863 wurde er k.k. Hofball-Musikdirektor – bis 1871. Mit seinem Orchester war er in ganz Europa unterwegs – aber auch in Nordamerika. Er hat ein reiches kompositorisches Werk hinterlassen: aber nur eine einzige Oper, „Ritter Pazman“, obwohl manchmal auch „Prinz Methusalem“ und „Simplicius“, beides eigentlich Operetten, als Opern geführt werden.
Ein Ballett „Aschenbrödel“, Fantasien, Märsche, Mazurken, Orchesterwerke, eine Polonaise, ein Präludium, Romanzen, etliche Rondos und vor allem Tänze (Walzer, Polkas, Csardas, und Quadrillen) entstammen seiner Feder – fast 500. Erst ab dem Jahr 1871, also 46-jährig, komponierte er Operetten. Viele seiner Operetten kennt man heute nicht mehr, manche sind erst posthum zusammengestellt worden. Es wird im Laufe des Jahres noch ausreichend Gelegenheit geben, auf Johann Strauss einzugehen.
Fast kein Monat vergeht ohne eine Oper eines der wichtigsten Komponisten Italiens: Giuseppe Verdi. War es im Jänner sein großartiger „Attila“, wird diesmal die „Urfassung“ seines „Un ballo in maschera“ (Ein Maskenball) gesendet: „Gustavo III.“! Es handelt sich hier um die unzensierte Fassung aus dem Jahr 1857 – eben mit Gustavo III., König von Schweden, und nicht mit Riccardo (Richard), dem Gouverneur von Boston.
Aber es gibt auch noch zwei weitere Opern, basierend auf dem Stoff von Eugène Scribe: „Gustave III. ou Le Bal masque“ (Gustav III oder Der Maskenball) von Daniel Francois Ésprit Auber, uraufgeführt im Jahr 1833 in Paris (spielt in und bei Stockholm im März 1792), sowie „Il Reggente“ (Der Regent) von Saverio Mercadante, mit Uraufführung im Feber 1843 in Turin
(Erstfassung), und im November 1843 in Triest (Zweitfassung). Hier ist der Schauplatz der Handlung Schottland – im 16. Jahrhundert. Es ist höchst interessant, auch diese beiden Opern zu hören – von beiden liegen mir Aufnahmen vor.
Besonders möchte ich auf Aubers „Manon Lescaut“ aufmerksam machen, die man heute kaum mehr kennt. Sie wurde zuerst durch Massenets „Manon“ (UA 1884 in Paris) und in weiterer Folge durch Puccinis „Manon Lescaut“ (UA 1893 in Turin) von den Spielplänen verdrängt.
Radio Klassik Stephansdom ist leider noch nicht gerettet! Und so wiederhole ich meine Bitte um Spenden an:
Stiftung Radio Stephansdom
IBAN: AT74 1919 0001 3922 7440
BIC: BSSWATWWXXX