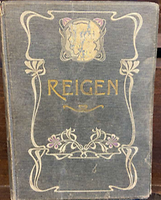ZUM ERFOLG#
Oscar Blumenthal, der deutsche Schriftsteller berichtet 1904 in einem Feuilleton „Zur Psychologie des Erfolges“ folgendes: Als er mit dem ungarischen Dichter Ludwig Doczi durch die Lorbeerwälder von Abbazia streifte begannen sie verschiedene Themen aufzugreifen, um den langen Weg dadurch zu verkürzen. Und so kamen sie auf die sonderbaren Geheimnisse des Erfolges und des Misserfolges zu sprechen.
„...wir stimmten darin überein, dass große und dauernde Erfolge selten oder niemals auf glatter Bahn gewonnen werden. Sie müssen, wie die Ruhm reichsten Siege der Kriegsgeschichte, über Hemmungen und Widerstände erkämpft worden sein, wenn sie Bestand haben sollen. Mit einem Blick auf das Lorbeerdach, das den Weg leuchtend überwölbte, machte im Zusammenhang dieser Unterhaltung Ludwig Doczi eine Bemerkung, die sich mir unwillkürlich zu einem Vierzeiler zusammenschloss.
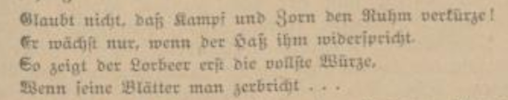
Wer die Geheimgeschichte des Erfolges schreiben könnte, er würde auf Schritt und Tritt diese Bemerkung bestätigt sehen. Ja, so wahr und erprobt ist sie, dass bisweilen die Dichter, die keinen ernsthaften Widerständen begegnen, listige Hilfsmittel anwenden, um sich zu erfinden. Denn die Verfolgung ist zu allen Zeiten der mächtigste Hebel des Ruhms gewesen … Man muss nur in der Wahl seiner Verfolger recht vorsichtig sein; man muss sie sich gelegentlich selbst auf die Fersen hetzen - und man wird damit eine schärfere Menschenkenntnis bewiesen haben, als mit jeder schmeichelnden Werbung um Gunst und Beifall.
Das scheint paradox. Aber vielleicht wird man mir zustimmen, wenn ich einige Ateliergeheimnisse ausgeplaudert habe, die übrigens schon längst die Spatzen von den Dächern pfeifen.
Kennen Sie die Geheimgeschichte des größten Bucherfolges, den Arthur Schnitzler bis heute errungen hat? Vor einigen Jahren schrieb er mit kecker Feder und in der sprudelndsten Anatole Laune ein Dutzend erotischer Lebensbilder, die mit einem satirischen Grundgedanken geschickt aneinander genietet waren. Aber so gewagt auch die Stoffe der zwölf Dialoge waren, die der Dichter unter dem Titelschild „Reigen“ vereint hatte, so versteht es sich bei einem ernsthaften Poeten, wie Arthur Schnitzler, von selbst, dass er sich der Muse auch diesmal in ehrbarer Absicht genähert hat, und die künstlerische Sauberkeit seinen Unsauberkeiten würde zuletzt ihre Verzeihung erschmeichelt haben.. Gleichwohl hielt ihn als das Buch fertig vorlag, ein schamhaftes Widerstreben von der Veröffentlichung zurück. Er mochte sich nicht dem Missverständnis aussetzen, dass die scharfen Würzen, die er in seine Gespräche hatte schütten müssen, etwas anderes sein könnten, als künstlerische Hilfsmittel der Gesellschaftskritik. Und so beschloss er denn - ganz im Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts – sein Buch nur als „Manuskript für Freunde“ drucken zu lassen und jedes Exemplar mit einer Erkennungsziffer handschriftlich zu zeichnen.
Man wird mein Erstaunen und meine Heiterkeit verstehen, als ich auf dem Exemplar, das ich selbst der Liebenswürdigkeit des Dichters verdanken durfte, die Ziffer Hundertdreißig fand.. Der „Reigen“ war also schon damals ein in den weitesten Kreisen verborgenes Buch gewesen … Hundertdreißig vertrauten Freunden hatte der Verfasser seine Dialoge bereits ins Ohr geflüstert. Unter hundertdreißig Siegeln der Verschwiegenheit war das Buch in die Weite gesandt worden. Nie hat es ein lauters Geheimnis gegeben. Nie ist Diskretion und Mitteilsamkeit so geschwisterlich verknüpft gewesen. Und wen mag es verwundern, dass ein Geheimnis, das so viele Mitwisser besaß, in immer breiteren Wellenringen sich ausdehnen musste? Immer lauter und verlangender wurde der Ruf der Neugier, und so entschloss sich der Autor endlich das Selbstverbot aufzuheben, durch das er als sein eigener Zensor sein Buch so begehrenswert gemacht hatte...
Es hatte bis heute fünfundzwanzig Auflagen erlebt.Und daraus ergibt sich, dass die Verheimlichung eines Buches das beste Hilfsmittel der Veröffentlichung ist und dass man, um ein Werk bekannt zu machen, nichts besseres tun kann, als es möglichst geräuschvoll zu verbergen.
Hat in dem vorliegenden Fall der Dichter selbst, der seine Schöpfung hinter Schloss und Riegel eingekerkert hatte, die Hemmung geschaffen, die dem Buch später eine so breite Bahn öffnen musste, so ist in anderen Fällen bisweilen die königliche Staatsanwaltschaft so liebenswürdig, einem wankenden Erfolg durch ein Verbot zu Hilfe zu kommen. Zahllos sind aus den letzten Jahren die Beispiele, in welchem sich die Anklage nur als eine neue Form des Mäzenatentums bewährt und einem Buch gerade die Leser zugeführt hat, die ihm entzogen werden sollte.
Bezeichnend ist, was Hans von Kahlenberg mit dem „Nixchen“ erlebt hat. Hinter diesem Pseudonym versteckt sich bekanntlich eine vornehme junge Dame, die ihren zarten Familiensinn dadurch bekundet, dass sie unter ihre schriftstellerischen Arbeiten einen anderen Namen setzt. Ihr „Nixchen“ baut sich auf einer künstlich zusammen geschobenen und noch künstlicher aufrecht erhaltenen Erfindung, die auf einer Nadelspitze schaukelt. Zwei Freunde erzählen sich in Briefen ihr letztes Liebeserlebnis. Bei dem einen handelt es sich um ein züchtiges und keusches Mädchen, das er heiraten will; bei dem anderen um eine an Marcel Prevost herangebildete Halbjungfrau, die sich ihm zügellos in die Arme wirft. Die Pointe liegt darin, dass das keusche Mädchen und die lüsterne Halbjungfrau eine und dieselbe Person ist...
Nach vier Auflagen hätte man von der mittelmäßigen und erklügelten Arbeit kaum noch gesprochen, als sie plötzlich „Ärgernis erregte“. Aber nicht etwa bei dem Verleger, der vergebens auf die fünfte Auflage wartete, sondern bei einigen Mumien männlichen und weiblichen Geschlechts. Nun wurde ein hochnotpeinliches Gerichtsverfahren eröffnet, das sich von Instanz zu Instanz bis zum Reichsgericht wälzte und ein verblühtes Buch wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Als es vollends in Deutschland verboten wurde, war es reif für einen österreichischen Verlag geworden, der sich als ein Asyl für verfolgte Romane aufgetan hat, und nun konnte das verwelkte und runzlig gewordene „Nixchen“ zu einem Erfolg kommen, den es in seiner Sünden Maienblüte niemals erreicht hatte.
Ist es ein Wunder, dass sich nach solchen Beobachtungen unter den Schriftstellern neben dem Honorar- und Tantiemenneid auch der Verbotneid bereits bemerkbar macht? Es ist die jüngste Blüte der schriftstellerischen Nächstenliebe.
Feiner und erfreulicher sind die psychologischen Vorgänge, die einen Erfolg werden und wachsen lassen, wenn die Gerechtigkeitsliebe und der Selbständigkeitsdrang des Publikums durch einen Eingriff der Macht aufgewühlt wird. Mehr als einmal hat das Tadelswort eines Fürsten genügt, um einem Kunstwerk sofort die leidenschaftlichen Huldigungen der Menge zuzuführen, welche sich in ihrem demokratischen Gewissen mit Recht beunruhigt fühlt, wenn auf dem Gebiet des Kunstgeschmacks das Gewicht fürstlicher Autorität eingesetzt werden soll. Darum wäre in der Psychologie einer älteren Zeit stecken geblieben, wer sich gegenwärtig mit seinem künstlerischen Schaffen den Beifall hoher Herren erbuckeln möchte. Wer im Gegenteil planvoll und scharfsinnig danach streben wollte, sich die Ungunst der Mächtigen zu erwerben, er würde uns das feinste und listigste Widerspiel der Ehrfurcht anschaulich machen. Denn überaus empfindlich ist die Menge gegen jede Beeinflussung der ästhetischen Gerichtsbarkeit durch einen Wink aus der Höhe – und schwer ist ein Kranz errungen, aber leicht eine Märthyrerkrone.
Man erinnere sich an das seltsame Schicksal das Gerhart Hauptmann „Rose Bernd“ in Wien gehabt hat. Das Drama hatte bei der ersten Aufführung nur mäßige Teilnahme gefunden. Die Kritik fand es unerfreulich und peinigend; das Publikum sah sich mehr gequält als erschüttert, und der dünne Erfolg wäre bald in sich selbst verkümmert und zusammengesunken. Da erkannte das Oberhofmeisteramt, dass es dem Dichter zu Hilfe kommen müsste. Es gönnte dem Werk nicht seinen natürlichen Tod im Spielplan, sondern verbannte es durch einen höfischen Machtspruch – und damit hat es dem Drama nicht bloß den werbenden Eifer einer anderen Wiener Bühne gewonnen, sondern auch die leidenschaftliche Parteinahme der nämlichen Kritiker, die sich vorher kühl und ablehnend verhalten haben. Sie gestatteten dem Oberhofmeisteramt nicht, ihre eigenen Meinung zu sein – jenem Ehemann ähnlich, der im stetem Unfrieden mit seiner Schwiegermutter lebte, aber einem Dritten, der ihr unartig begegnen wollte, entrüstet zurief: „Ich bitte, mit meiner Schwiegermutter raufe ich!“ „Mit Gerhart Hauptmann raufen wir!“ riefen die Wiener Kritiker. Und sie hatten Recht. Denn ästhetische Fragen dürfen dürfen nur in dem ehrlichen Kampf von Gründen gegen Gründe entschieden werden. Wie eine schützende Phalanx stellten sich die Kunstrichter Wiens vor das bedrohte Werk – und so konnte der Dichter schließlich einen Erfolg des Widerspruchsgeistes erringen, wo ihm ein Erfolg der dramatischen Kunst versagt gewesen war.
Der Trotz- und Justamenterfolg, der die Lehre gibt, dass literarische Geschmacksströmungen nur aus sich selbst heraus überwunden werden sollen, bestätigt am deutlichsten, dass der Weg zu den großen Siegen stets über Hindernisse führen muss. Ich habe deshalb die Schriftsteller niemals verstanden, die so wehleidig dreinschauen, wenn ihre Bahn durch Kampf und Verfolgung geht. Der Poet, der keine Widersacher mehr findet, darf gewiss sein, dass sein Schaffen auf ein totes Geleise geraten ist – und die Psychologie des Ruhms lehrt uns unüberhörbar:
Das Maß unserer Kraft berechnet sich nach der Zahl der Menschen, denen wir unbequem werden.
QUELLE: Czernowitzer Tagblatt 15. Juni 1904, S 2, ANNO Österreichische Nationalbibliothek
https://austria-forum.org/af/User/Graupp Ingrid-Charlotte/ZUM_ERFOLG
Zurück zur Übersicht über alle Beiträge